© Die Rechte für das Cover liegen beim Verlag und beim Urheber
Warum Anthony Burgess’ ‘A Clockwork Orange’ auch noch lesen?
Ich vermute, dass die meisten von euch den Film Clockwork Orange von Stanley Kubrick aus dem Jahre 1972 kennen dürften. Einfach horrorshow meine Droogs! Und ich vermute weiterhin, dass es der Mehrzahl von euch so gegangen sein dürfte wie mir: Am 1962 von Anthony Burgess veröffentlichten Roman aus dem Jahr bin ich bisher vorbeigegangen. Nun hat euer treuer Rezensent dieses Werk einmal mutig in seine Rucke genommen und siehe da, es war ein Fehler zu denken, dass es im Vergleich mit dem phantastischen Streifen des unglaublichen Kubrick, Bog hab ihn selig, meine Freunde, den Kürzeren ziehen müsste. Deshalb folgt nun ein bisschen nicht so spannendes Quorietsch über den Inhalt. Dann aber werde ich, euer treuer Freund und Rezensent, euch sagen, was dieses Wetsch vom Film unterscheidet und warum ihr es einmal lesen solltet, obwohl ihr euch vor der flimmernden Globovisionskiste nach einem rabottvollen Tag schon verdientermaßen damit habt berieseln lassen.
Auch für die Uhmnis, die den Film schon kennen: Der Inhalt
1. Teil: In einer gar nicht so fernen erscheinenden Zukunft (des Jahres 1962) vertreiben sich 15-jährige Alex und seine Kumpels Dim, Pete und Georgi ihren Abend damit, erst in der Korova-Bar Milch mit synthetischen Drogen zu nehmen und dann auf den Straßen ihrer englischen Heimatstadt einen Obdachlosen zu verprügeln, einen älteren Mann zusammenzuschlagen, sich ein blutiges Handgemenge mit einer andern Gang zu liefern und nach dem Diebstahl eines Autos vor den Toren der Stadt die Frau eines Schriftstellers zu vergewaltigen. Auch der nächste Tag ist ereignisreich: Erst wird der Ich-Erzähler von seinem Bewährungshelfer besucht, welcher vermutet, dass sein Schützling an den Verbrechen des Vorabends beteiligt gewesen ist, und ihn deshalb vor weiteren Straftaten warnt, dann lockt der Musikliebhaber Alex zwei minderjährige Mädchen in sein Zimmer in der elterlichen Wohnung und vergewaltigt sie. Am Abend kommt es aufgrund seines Führungsstiles zu Spannungen innerhalb der Gang. Auch wenn Alex später meint, durch das bewährte Mittel der Gewalt die von ihm präferierte Hackordnung wieder hergestellt zu haben, ist dem nicht so. Seine Droogs sinnen auf Rache und tricksen ihn aus. Nachdem Alex in ein Haus eingestiegen ist und dort einen Totschlag an einer älteren Frau begangen hat, schlagen sie ihn nieder, damit er der Polizei, die schon im Anrücken ist, in die Hände fällt. Aufgrund seines umfangreichen Vorstrafenregisters wird der Ich-Erzähler inhaftiert und zu 14 Jahren Haft verurteilt.
2. Teil: Im Gefängnis beginnt Alex die Bibel zu lesen und hilf dem Gefängnispfarrer. Obwohl es nach außen hin wirkt, als habe er eine moralische Läuterung erfahren, ist dem nicht so. Vielmehr begeistert er sich an den Gewalt- und Sexzenen der Heiligen Schrift. Nach einer zweijährigen Haft versucht er Teilnehmer an einem neuartigen Programm der Regierung für gewalttätige Straftäter zu werden, um schneller aus dem Gefängnis entlassen werden zu können. Alex gelingt dieses tatsächlich. Nach einer zweiwöchigen Gehirnwäsche, während der ihm äußerst gewalttätige Bilder- und Videosequenzen zu klassischer Musik vorgeführt werden, ist der Protagonist nicht mehr in der Lage selbst Gewalt auszuüben und wird deshalb als geheilt entlassen.
3. Teil: Nach Hause zurückgekehrt, stellt Alex fest, dass seine Eltern, die sich nie für ihn wirklich interessiert haben, sein Zimmer vermietet haben. Obdachlos umherziehend wird er von dem Obdachlosen, den er selbst zwei Jahre zuvor verprügelt hat, und dessen Kumpanen zusammengeschlagen. Wenig später fällt er Georgi und Dim in die Hände, die nun zwar Polizisten sind, sich aber davon nicht hindern lassen, ihrem ehemaligen Anführer eine Lektion zu erteilen. Außerhalb der Stadt zurückgelassen flüchtet sich Alex ausgerechnet in das Haus jenes Schriftstellers, dessen Frau er dereinst vergewaltigt hat. Dieser erkennt ihn jedoch nicht als Täter. Er versucht vielmehr aus politischen Intentionen heraus Alex zu helfen und als Opfer der neuartigen Therapie zu inszenieren. Nachdem er aber herausfindet, dass Alex der Vergewaltiger seiner Frau ist, sorgt er durch das Abspielen klassischer Musik, die Alex seit seiner Gehirnwäsche ebenso wie Gewalt nicht mehr ertragen kann, dafür, dass Alex durch einen Sprung aus dem Fenster versucht sich das Leben zu nehmen. Aufgrund der hierdurch ausgelösten Diskussion über die neue Therapieform wird Alex einer Dekonditionierung unterzogen und erhält das Angebot, in den Staatsdienst einzutreten.
Im nichtverfilmten Schlusskapitel begeht Alex nach dem bekannten Besuch in der Korova-Bar zwar wieder Verbrechen, beschränkt sich aber darauf Anweisungen zu erteilen. Gewalt übt er selbst nicht mehr aus. Zuletzt verlässt er die Gang und träumt von einer Frau und Kindern.
Ins Detail nun: Warum auf ein solches Werk noch seine kostbare Zeit verwenden
Im Gegensatz zum Film endet der Roman – wenn auch sehr überraschenden und scheinbar recht unmotiviert – möglicherweise positiv. Dieses wird zumindest von einigen behauptet. Alex begeht keine Gewaltexesse mehr und er scheint ihnen zu entwachsen. Damit ändert sich auch die Aussage dieser Dystopie. Es wird nicht ein Gewaltverbrecher von einem skrupellosen Politiker in den Staatsdienst übernommen, sondern der Mensch Alex entwirft sich freiwillig nach den ihn bekannten Rollenmustern neu. Fraglich bleibt dabei aber, ob man dieses als einen Akt der Freiheit interpretieren kann, denn es gibt durch die häufigen Anspielungen auf sein fortschreitendes Alter – Alex ist jetzt Anfang 20 – deutliche Hinweise darauf, dass es sich hier um eine natürliche Entwicklung handelt. Je nachdem, wie man die Frage nach der Determination des Menschen beantwortet, fällt auch die Interpretation des Gesamtwerkes aus. Die Frage nach der Freiheit des Menschen ist aber das zentrale Thema des Romanes: Nicht nur, dass Alex aufgrund seiner sozialen Herkunft, und des lieblosen Umganges seiner Eltern mit ihm manchmal auch als Opfer erscheint, worin auch die Ursachen für sein gewalttätiges Verhalten gesehen werden können, die Konditionierung, der er unterworfen wird, beraubt ihn der freien Wahl zwischen ‘Gut’ und ‘Böse’. Wenn aber er am Ende tatsächlich nur aus Altersgründen den Weg ins bürgerliche Dasein einschlägt und ‘das Gute’ wählt, dann wirkt er auf mich nicht wirklich frei in seiner Entscheidungsfindung, zumal die letzten Sätze nicht nach einer wirklichen Läuterung klingen: Ihr aber, o meine Brüder, gedenket manchmal eures kleinen Alex, wie er einst gewesen. Amen. Und all so Zeug.
Üblicherweise wird der Titel des Romanes Uhrwerk Orange (auf dessen Ursprung gehe ich hier jetzt nicht näher ein) als Ausdruck dafür gewertet, dass der Mensch nicht wie eine Maschine funktioniert. Dieser Auffassung bin ich aber nicht. Dass Alex am Ende selbst erwartet, dass sein noch zu zeugender Sohn zur rechten Zeit in gleichem Maße Gewalt wie er selbst ausüben wird, während er selbst – beinahe mit Glockenschlag – scheinbar unmotiviert beschließt, ein bürgerliches Leben zu führen, gibt dem Titel Uhrwerk Orange meiner Ansicht nach eine ganz andere Bedeutung.
Kubrick hat die von Burgess entworfene Kunstsprache mit am Russischen orientierten Wörtern nur in Ansätzen übernommen. Im Roman werden diese nicht nur häufiger verwendet, dort wird auch vom Ich-Erzähler Alex die gesamte Handlung in diesem Slang wiedergegeben, – während im Film nur streckenweise die Stimme aus dem Off die Geschehnisse kommentiert:
Drei Dewotschkas saßen zusammen an der Theke, aber wir Maltschicks waren zu viert, und meistens spielten wir einer für alle und alle für einen. Auch bei diesen Girls waren die Plattis voll im Trend, und sie hatten Perücken auf den Gullivers, lila, grün und orange, von denen sicherlich keine weniger als drei, vier Wochenlöhne gekostet hatte, wie solche Schnallen sie verdienen, und dazu passend das Make-Up, mit Regenbogen um die Glassis und die Flappe dick ausgemalt.
Dadurch erhält der Roman eine eigentümliche Atmosphäre, die zwar auch dem Film nicht fremd ist, aber sich doch von dessen deutlich unterscheidet.
In dieser Form stellt die Sprache des Romans durchaus eine Herausforderung für den Leser dar. Wenn diese aber gemeistert wird, wächst mit der zunehmenden Vertrautheit auch die Nähe zum Ich-Erzähler. Denn Alex lässt uns in seinem Slang an seinen innersten Gedanken teilhaben, zumal der Leser auch immer wieder direkt, beinahe als Vertrauensperson, angesprochen wird. Die schwache Wirkung, die der Film in dieser Hinsicht erzielt, kann in keiner Weise mit der des Romanes verglichen werden.
Dass diese Nähe trotz der Verbrechen des Protagonisten überhaupt hergestellt werde kann, liegt in der spezifischen Präsentation der zahlreichen Gewalttaten. Während Kubrick versucht deren Wirkung auf den Zuschauer durch filmische Verfremdungseffekte wie Zeitlupe, Zeitraffer und Kamaraperspektive abzuschwächen, so gelingt Burgess dieses sprachlich durch die Verwendung von Wörtern, hinter denen die Brutalität bildlich kaum zu fassen ist. So kann sich der Leser unter dem Kroffi, das aus dem Gulliver strömt, nur schwerlich einen blutenden Kopf vorstellen, zumal die Beschreibungen, die Alex dem Leser gibt, nie einer gewissen humoristischen Komponente entbehren, die das Geschehen einerseits der Wirklichkeit entheben und andererseits die Aufmerksamkeit auf den Erzähler und seine Erzählweise selbst lenken. Zudem bedient sich Alex überwiegend eines sehr elaborierten und gehobenen Stiles, dem man von einer solchen Figur eigentlich kaum erwarten würde. Es ist die Kombination dieser sprachlichen Merkmale, die den Roman zu einer einzigartigen Leseerfahrung machen.
Fazit
Um es am Ende kurz zu manche, meine Brüder und Leser, euer treuer Rezensent rät euch, bezeiten eure Glassis in das Buch zu stecken, denn sein hoher Genuss wird auch nicht gemindert, so man den Film schon kennen sollte. Und obwohl der Roman schon 40 schwere Jahre auf seinem Buckel trägt und als Klassiker Verehrung zu genießen verdient, scheint er selbst nicht alt geworden. Also Lesen mal. Und all son Zeug.


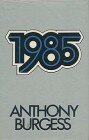
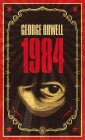
Dieses Buch gibt es, habe ich kürzlich erfahren, seit einem Jahr in einer neuen Übersetzung im Klett-Cotta-Verlag.
Das Magazin “fluter” der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) berichtet im April 2014 darüber als “Lesetipp” mit dem Titel
“Hier kommt Alex! Perspektiven auf ‘A Clockwork Orange’”.
http://www.fluter.de/de/134/lesetipp/12804/