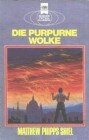© Die Rechte für das Cover liegen beim Verlag und beim Urheber
Kalte Einsamkeit: Jürgen Domians Der Tag, an dem die Sonne verschwand
Eine Buchbesprechung von Rob Randall
Schon seit Jahren talkt Jürgen Domian in seiner nach ihm benannten Sendung zu den verschiedensten Themen mit all jenen, die irgendetwas zu sagen oder zu berichten haben. Und so verschieden die Lebensbeichten, die Schicksalschläge und Werdegänge sind, die auf den Hörer von einslive oder den Zuschauer des WDR niedergehen, so zeichnen nicht wenige zwei gemeinsame Merkmale aus: Viele der bedrückenden Geschichten, die die Menschen dort in ihrer Anonymität erzählen, sind geeignet, den Zuhörer frösteln zu lassen; wenn sie nicht gleich – und das gilt auch für die weniger niederschmetternden Erzählungen – das kalte Grausen heraufbeschwören.
Und nicht wenige der bitteren Lebensgeschichten haben irgendetwas mit Verlust zu tun: dem Verlust von geliebten Partnern, der Familie, Freunden – oder auch gleich des ganzen bisherigen Lebens. Und mit jener Aufgabe, die der Mensch letztendlich nur alleine und für sich selbst bewältigen kann: Der Verarbeitung des Geschehenen. Da verwundert es nicht, dass sich Jürgen Domians 2009 erschienener Roman vorwiegend diesem Thema widmet.
Und welches Genre böte sich da nicht besser an als jener hochreflexive Grenzgänger zwischen Katastrophenroman und Postapokalypse, in dem nicht nur der Verlust selbst Program ist, sondern der den Protagonisten in seiner Vereinsamung auch auf sich und sein Leben als Letztes zurückwirft: Das Genre des Letzten Menschen (1).
Der Tag, an dem die Sonne verschwand in der Kritik
Dieser Wahl des Genres und der damit einhergehenden höchst paradoxen Erzählsituation ist auch die Form des Romans geschuldet. Denn Der Tag an dem die Sonne verschwand ist eine zwischen Ereignisbericht und Autobiografie oszilierende Chronik, ein Tagebuch, das sich nur noch an einen hypothetischen, wenn auch erhofften, Leser wenden kann. Es erscheint insofern auch ungerecht, wenn dem von Feuilleton weitgehend unbeachteten Roman in Netzrezensionen vorgeworfen wird, er zeichne sich durch Handlungsarmut und die wenig packende Schilderung einer Lebensgeschichte aus. Ungerecht sind solche Beurteilungen nicht deshalb, weil die Feststellungen unzutreffend wären – denn wer ‘Aktion’ in Der Tag an dem die Sonne verschwand sucht, sucht diese tatsächlich vergebens -, ungerecht erscheinen sie vielmehr, weil die sich hier artikulierende deutlich enttäuschte Leseerwartung der Zielsetzung des Romans selbst nicht gerecht wird.
Schon das im Mysteriösen verbleibende Szenario deutet hierauf hin: Denn die Katastrophe, das Verschwinden aller anderen Menschen, steht zwar im Zentrum, verweist aber mit ihren rätselhaften Begleiterscheinungen – wie der plötzlich hereinbrechenden monatelangen Dunkelheit, dem Schneefall und dem aufziehenden Nebel, welcher vor dem Fenster der Eremitage unserer männlichen Hauptfigur aufzieht, – zeichenhaft auf jenen, durch einen Autounfall schon längst erlittenen Verlust: den der geliebten Marie – denn diese kann der Held auch nach langer Zeit nicht loslassen; immer wieder belasten ihn Schuldgefühle angesichts seines damaligen Verhaltens.
Während sich in Haushofers Roman Die Wand die schon vor der eigentlichen Katastrophe gewählte Selbstisolation in einer in ihren Ursprüngen ebenfalls unerklärt bleibenden Mauer manifestiert, bekommt Domians Held die Katastrophe, die er – man möge die Formulierung entschuldigen – “verdient”. Das Szenario extremisiert und veräußerlicht somit das Innenleben des Helden – und ist deshalb hier auch zeichenhaft zu lesen. Eine weitergehende, womöglich sogar wissenschaftliche, Ausgestaltung der Hintergründe des Szenarios, wie so hier und dort - und übrigens auch in den Besprechungen ähnlicher Romane des Genres – gefordert wird, würden dem nur zuwiderlaufen. Konsequent und folgerichtig hat Jürgen Domian hier gearbeitet. Wer einen postapokalyptischen SF-Abenteuerroman lesen will, der sollte von Der Tag, an dem die Sonne verschwand, die Finger lassen.
Der Weg hinaus aus der Isolation
Wenn man so als Zentrum des Romans die Beschäftigung des Protagonisten mit den erlittenen Verlusten ausmacht, stellt sich die Frage, wie gut es Jürgen Domian eigentlich gelungen ist, das Innenleben seines Helden zu gestalten. Deutlich schöpft hierbei aus den Erfahrungen, die er in seiner Sendung sammeln konnte. Die Entwicklungsschritte des Helden aus seiner erst selbstgewählten und später erzwungenen Isolation sind dementsprechend überzeugend und nachvollziehbar, bieten allerdings - abgesehen von der damit einhergehenden Schilderung sexueller Episoden – doch wenig Überraschendes. Hier und da wünscht man sich, dass der Held, auf dessen Reflexionen der Leser einfach zu stark angewiesen bleibt, sein Leben etwas deutlicher und tiefer durchblicken würde. Aber welcher von Verlust in Leben und Psyche deformierte Mensch könnte das schon in einer solchen Situation?
Die mangelnde Reflexionsfähigkeit des Helden stört aber trotzdem – vor allem auch deshalb, weil sich der Roman – seiner Zielsetzung gemäß – eher dem Modus des “Telling” als dem des “Showing” bedient. Der Horizont, der sich dem Leser öffnet, geht somit leider kaum über den des Protagonisten heraus. Hinzu kommt die weitgehend einfache Sprache der überwiegend berichtenden Tagebucheinträge. Das alles kann enttäuschend sein – und dürfte vornehmlich all jene Leser ansprechen, die selbst große Verluste verarbeiten mussten oder noch müssen: Auch deshalb schließt der Roman mit einem gelungenen Ende, das eben nicht offen ist, wie manche Netzkritiken behaupten, sondern den mitleidenden Leser auffordert, sich vom Vergangenen und dem eigenen Rückzug zu verabschieden und neu in die Zukunft und auf die Welt zu blicken – gleich, ob da draußen noch jemand auf ihn wartet.
Fazit
Jürgen Domians Roman bietet zwar ein mysteriöses Szenario, dieses bleibt jedoch zeichenhafter Hintergrund der Persönlichkeitsentwicklung des Helden, die im Zentrum der Betrachtung steht. Obwohl Der Tag, an dem die Sonne verschwand konsequent konstruiert ist, überzeugt der Text nicht ganz: Zu stark muss der untätige Leser den geistigen Fußstapfen folgen, die der verzweifelte dahintippelnde Held im winterlichen Köln hinterlässt.
(1) Zur Konstitution des Genres durch die vom Motiv des Letzten Menschen bedingten narrativen Programme siehe: Judith Schoßböck, Letzte Menschen. Postapokalyptische Narrative und Identitäten in der Neueren Literatur nach 1945, Bochum, 2012. Behandelt wird in dieser Monografie auch Jürgen Domians Roman.