© Die Rechte für das Cover liegen beim Verlag und beim Urheber
Es ist das Individuum, Dummkopf: Rezension von Robert A. Heinleins Starship Troopers
Eine Buchbesprechung von Stefan Cimander
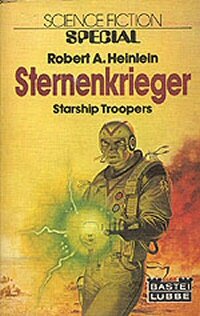 „Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst!“, sagte John F. Kennedy 1961. Als zentrale Motivation flecht sich Kennedys Äußerung in das drei Jahre zuvor publizierte, novellenartige Sternenkrieger (Starship Troopers) von Robert A. Heinlein ein. Denn in dem schon zeitgenössisch kontrovers rezipierten Traktat verteidigt Heinlein den amerikanischen Pioniergeist vor dem Hintergrund der Bedrohung durch den Kommunismus und dem schleichenden Niedergang der Gesellschaft.
„Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst!“, sagte John F. Kennedy 1961. Als zentrale Motivation flecht sich Kennedys Äußerung in das drei Jahre zuvor publizierte, novellenartige Sternenkrieger (Starship Troopers) von Robert A. Heinlein ein. Denn in dem schon zeitgenössisch kontrovers rezipierten Traktat verteidigt Heinlein den amerikanischen Pioniergeist vor dem Hintergrund der Bedrohung durch den Kommunismus und dem schleichenden Niedergang der Gesellschaft.
Kontroverse als Konstante
Während 1997 Paul Verhoevens Heinlein-Verfilmung Starship Troopers in den Kinosälen flimmerte, geisterte das Damoklesschwert der Faschismus- und Gewaltverherrlichung durch die Feuilletons der Republik. Obwohl Verhoevens Interpretation stark von der literarischen Vorlage abweicht, wurde auch Heinlein zeitlebens für seine 1958 erstmalig als Starship Soldiers fortlaufend publizierte Serie gescholten.
Die eigentliche Erzählung von Starship Troopers ist banal und schnell zusammengefasst, fehlen ihr doch wesentliche Elemente einer auf Unterhaltung und Spannung angelegten Handlung. Es gibt keine Romantik, keinen Sex, Rico hat keinen Gegenspieler, es gibt nur wenige wichtige Charaktere, seitenlange Abhandlungen über militärische Doktrin, Politik und theoretisch-philosophischer Einlassungen lassen Starship Troopers in weiten Strecken mehr als eine Dokumentation denn als Roman erscheinen.
Vom Gefreiten zum Leutnant
Der Philippino Juan Rico erzählt memoirenhaft aus der Ich-Perspektive seine militärische Karriere, seine Erlebnisse im Krieg und erklärt das politische und gesellschaftliche System seiner Gegenwart. Das Buch beginnt mit der Schilderung einer Kommandomission und schlägt dann den Bogen zur Schulzeit. Durch seinen Kumpel mitgerissen, meldet sich der 18-jährige Rico nach bestandenem Abitur zum Militärdienst und landet bei der M.I., der Mobilen Infanterie, einer Teilstreitkraft, die so gar nicht Ricos Präferenzen entspricht. Für Rico ist der Militärdienst der einzige Weg, das Wahlrecht zu erhalten.
Obwohl die Ausbildung hart ist, kommen Rico erst spät Zweifel an seiner Entscheidung. Ein Brief seines Lehrers in Moralphilosophie überzeugt, ihn bei der M.I. zu verbleiben. Wenig später zerstören die Archanoiden („Bugs“) Buenos Aires, dabei kommt Ricos Mutter ums Leben. Als Gefreiter nimmt er an verschiedenen Kampfeinsätzen teil, bevor er sich für die Offizierslaufbahn meldet. Bevor er sein Offizierspatent erhält, muss Rico als Fahnenjunker an einer Mission teilnehmen, deren Zweck es ist, einen „Brain-Bug“ dingfest zu machen. Das Buch endet mit seinem ersten Einsatz als Leutnant.
Kampf als Teil der Erziehung
Heinlein schrieb Starship Troopers anfänglich als Jugendbuch, auch wenn es letztlich für Erwachsene veröffentlicht wurde, zielt Heinleins Intention auf die politische Erziehung. Heinlein beschreibt Ricos Reifeprozess, einen Prozess, der sich nur durch den Bundesdienst erreichen lässt und der Identität und Loyalität formt. Dies erinnert entfernt an Ernst Jüngers In Stahlgewittern.
Anschreiben gegen Amerikas Schwäche
Starship Trooperssetzt Kenntnisse in amerikanischer Geschichte, der gesellschaftlichen Werte und der weltpolitischen Lage der 1950er Jahre voraus. Insbesondere die Science-Fiction der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts reflektierte den Ost-West-Konflikt. Starship Troopers entsteht in einer der heißen Phasen des Ost-West-Konfliktes, in der Amerika das subjektive Gefühl hatte, den geopolitischen wie technischen Anschluss zu verlieren.
Heinlein selbst konstatierte die Ursache dieser Schwäche in der Nachgiebigkeit Amerikas gegenüber den Sowjets. Er hegte die Befürchtung, die Sowjetunion könne dieses Unvermögen für einen Überraschungsangriff ausnutzen. In Starship Troopers steht der Überraschungsangriff der Bugs auf Buenos Aires als Sinnbild für diese Angst und als Warnung vor dem Vernichtungspotenzial des Kommunismus.
Als Heinlein am 5. April 1958 eine Zeitungsanzeige des National Committee for a Sane Nuclear Policy liest, die einen unilateralen Stopp der Atombombentests propagiert, fühlt er sich in seinem Standpunkt bekräftigt. Starship Troopers ist die literarische Reaktion auf dieses Ansinnen und den konstatierten politisch-gesellschaftlichen Niedergang, steht gleichzeitig aber auch am Ende einer vom Ehepaar Heinlein erfolglos geführten Kampagne, die mit der Gründung der nach dem Kämpfer für die Individualrechte benannten „Patrick Henry League“ begann. Die Kampagne gegen den Stopp der Atombombentests brachte Heinlein viel Kritik ein, und verhinderte letztlich auch nicht das tatsächlich von 1959 bis 1961 vereinbarte Moratorium.
Kommunismus vs. Freiheit
Die Bugs sind eine kollektivistische Archanoiden-Gesellschaft, die in der dichotomisch skizzierten Welt des Robert Heinlein für den Kommunismus steht. Dem steht eine auf Freiheit und Selbstbestimmung basierende Menschheit (Amerika) gegenüber. Die von der Menschheit gegen die Bugs verteidigten Werte stimmen mit den klassisch-liberalen Werten des amerikanischen Gründungsmythos überein: Individualismus, Gleichheit, Freiheit, Schutz des Eigentums, Laissez-faire, Konstitutionalismus und Demokratie.
Auch was die militärische Taktik in Starship Troopers anbelangt, zeigen sich Parallelen zum Containment der Truman- und der Machtpolitik der Monroe-Doktrin. Die Bugs erobern Planeten, die Menschheit schlägt zurück. In der realen Welt der 1950er Jahre geschah nichts anderes. Der Westen verteidigte seine Werte nach dem Prinzip der Dominotheorie: Fällt ein Staat, dann fallen auch andere.
Beunruhigendes auch an der Heimatfront
Diesen Wertekonsens sieht Heinlein im Inneren stückweise außer Kraft gesetzt. Die weitreichenden Eingriffe des amerikanischen Bundesstaates infolge des New Deal, die Herausbildung eines militärisch-industriellen Komplexes, und der erzwungene Konformismus im Zeitalter des McCarthyismus ließen eine gigantische Bürokratie entstehen, deren Regelungswut nicht nur Heinlein als Übel empfand. Statt selbst die Initiative zu ergreifen, ist das Individuum verleitet, sich auf Staatshilfe zu verlassen.
Demgegenüber beklagt er den Verlust individueller Fähigkeiten. In Starship Troopers sind Mathematik und Wissenschaft deshalb essenziell für die Ausbildung der Soldaten. Wie das antike Vorbild der Spartaner oder der platonschen Wächter braucht ein Land Wissen und Fähigkeiten, um dem Feind entgegen treten zu können. Mit diesem Rekurs offenbart er das Unvermögen der USA, bei der Eroberung des Alls mit den Sowjets aufzuschließen. Heinleins Antwort ist einfach: Aufbau einer Wissensgesellschaft!
Es ist nur folgerichtig, wenn das Militär die einzige Institution darstellt, die die Menschen in dieser Situation schützen kann.
Heinleins Utopie
Ist Starship Troopers als unmittelbare politische Reaktion entstanden, verarbeitet er in dem Buch gleichwohl seine militärischen, politischen sowie gesellschaftlichen Ansichten. Heinlein will die Schwächen des politischen und gesellschaftlichen Systems offenlegen und seine Utopie zeigen. Gleichberechtigung der Geschlechter und Rassen ist für ihn selbstverständlich, in den 1950er Jahren geradezu revolutionäre Thesen.
Härte und Bestrafung in Erziehung und Justiz sind nach Heinlein der einzige Weg einen Menschen zum Guten zu erziehen. Diskussion, Therapie und die Ausweitung von Rechten führten seiner Annahme nach zu anschwellender Gewalt in der Gesellschaft. In seiner utopischen Gesellschaft gibt es keine Therapie und für bestimmte Vergehen gibt es nur den Strang. Dargestellt wird das in Starship Troopers am Fall des Soldaten Dillinger.
Verantwortungsbewusstsein als Staatsmaxime
Das Regierungssystem ist eine multiethnische Meritokratie, in der Bürger- und Individualrechte streng vom Wahlrecht getrennt sind. Letzteres muss sich jeder verdienen. Seine Idee dahinter ist, dass das Wahlrecht aus der Verantwortung entsteht, nur wer weiß, wofür er kämpft, sein Leben für diese Sache in die Wagschale geworfen hat, wer Pflicht- und Verantwortungsgefühl bewiesen hat, nur derjenige kann eine rationale politische Entscheidung treffen. Der Eintritt in den Bundesdienst ist sogar ein konstitutionell verbrieftes Recht. Wer eintreten will, muss aufgenommen werden.
Heinlein greift die Idee antiker Vorbilder auf: Die Spartaner waren die Vollbürger Spartas, deren Erziehung durch Abhärtung, Kampfsport, Disziplin und Verbot aller das leben erleichternden Bequemlichkeiten geprägt war. Ihre Ausbildung beinhaltete auch das Lesen und Schreiben. Platon nimmt in seinem idealen Staat Bezug darauf, indem er die Wächter als tragenden Stand ins Leben ruft, die gleichsam Seele und Körper ertüchtigen.
Heinlein schreibt, dass die Föderation sich selbst nicht als perfekt betrachtet, aber funktioniert. Auch Rom funktionierte, obgleich nicht perfekt, 500 Jahre lang, weil die Regierenden erkannt hatten, dass der Schlüssel im Verstehen von Rechten und Pflichten der Bürger lag.
Krieg ist kein Selbstzweck
Wann der Krieg gegen die Bugs begann, spielt für Heinlein keine Rolle. Das ist ein Manko, denn derartiges Räsonnement wäre dem Buch nicht abträglich gewesen. Andererseits herrschte in den 1950er Jahren die Ansicht vor, Gewalt sei eine Lösung, um des Überlebens willen. Aber, und auch hier steht die Mentalität ganz unter antiken Vorzeichen: Si vis pacem para bellum. Heinlein sieht, als ehemaliger Marineoffizier ganz in clausewitzscher Tradition stehend, den Krieg als Fortführung der Politik mit anderen Mitteln. Anders ist die Aussage, „Krieg ist kontrollierte Gewalt für einen Zweck“ nicht zu interpretieren.
Manipulation und Kontrolle durch Drogen
Was beim Lesen der Sekundärliteratur auffällt ist, dass die Rolle von Hypnose und Drogen in der Rezeption kaum Beachtung findet. Heinlein stellt dies als Notwendigkeit zur Steigerung der Effizienz dar, ist aber auch gleichzeitig eine Erklärung dafür, weshalb Rico sein Tun nicht kritisch reflektiert, es im Gegenteil gutheißt und begründet. Drogen und Hypnose sind ein Mittel der Kontrolle und Steuerung, die bereits in der Geschichte des Krieges Anwendung fand.
Heinlein, Faschist oder Libertärer?
Heinlein wird wechselweise als faschistisch, militaristisch, reaktionär, konservativ, liberal oder libertär, bezeichnet, gleichzeitig finden sich in Starship Troopers zahlreiche Bezugnahmen auf unterschiedliche politische Theoretiker. Allein die Tatsache, dass Nationalität und Ethnie in Starship Troopers keine Rolle spielen, jeder Bürgerrechte besitzt und die Bedeutung der individuellen Freiheitsrechte des Menschen hochgehalten werden, relativieren den Faschismusvorwurf.
Heinlein als Libertären par excellence zu bezeichnen, nur weil die libertäre Bewegung Bezug auf ihn nimmt, trifft nicht den Kern seines Schaffens. Im Grunde vertritt Heinlein die klassischen amerikanischen Werte. Gewalt und Krieg sind bei Heinlein jedoch eine existentielle, anthropologische Grundkonstante. Das widerspricht libertären Annahmen.
Fazit: Typisch amerikanisch
Will man Heinleins Werk im Allgemeinen und Starship Troopers im Speziellen in einem Satz zusammenfassen, ist eine Erkenntnis von Robert Scholes und Eric S. Rabkin am Besten dazu geeignet, indem Sie Heinlein als „the most typically American writer in all the rankes of science fiction“ [1] bezeichnen. Heinlein zeichnet sich durch den spezifischen amerikanischen Patriotismus und den Bezug auf klassische amerikanische Wertvorstellungen aus, weshalb ihm bereits in den 1940er Jahren nachgesagt wurde, er schreibe die zukünftige amerikanische Geschichte.
Quellen und Literatur
- Birkenhauer, Franz: Kein Staat, kein Gott. In: sf magazin vom 14.07.2009. (Link)
- Brodocz, André; Gary S. Schaal: Politische Theorien der Gegenwart I.
- Cox, Patrick: Robert A. Heinlein: A Conservative View of the Future. In: The Wall Street Journal, 10.12.1985. (Link)
- Dath, Dietmar: Mondbesiedlung. Luna, die strenge Geliebte. In: FAZ vom 12.01.2004.
- Dath, Dietmar: Robert A. Heinlein. Er konnte alles außer irdisch. In: FAZ vom 07.07.2007
- de Sousa Causo, Roberto: Citizenship at War. Übersetzung aus dem portugiesischen: Carlos Angelo. In: O Jornal da Tarde vom 21.02.1998. (Link)
- Fenske, Hans; Dieter Mertens; Wolfgang Reinhard; Klaus Rosen: Geschichte der politischen Ideen: Von der Antike bis zur Gegenwart.
- Geib, Richard: STARSHIP TROOPERS by Robert A. Heinlein an opinion. (Link)
- Gifford, James: The Nature of “Federal Service” in Robert A. Heinlein’s Starship Troopers. 1996 (Link)
- Harbach, Thomas: Hardy Kettlitz: SF Personality 20 Robert A. Heinlein. (Link)
- Jürgens, Dirk M.: “Starship Troopers”-Doppelreview. In: Weird Fiction vom 08.07.2010. (Link)
- Krausser, Helmut: Faschismus light im Weltall. Paul Verhoevens Sternenkriegsfilm „Starship Troopers“ ist ein frivoles Meisterwerk. In: Der Spiegel, 5/1998, S. 179.
- Lösche, Peter (Hrsg): Länderbericht USA. Schriftenreihe der Bundeszentrale für politische Bildung, Bd. 690, Bonn 2009.
- Loth, Wilfried: Helsiniki, 1. August 1975. Entspannung und Abrüstung. München 1998.
- McGiveron, Rafeeq O.: “Starry-eyed internationalists” versus the Social Darwinists: Heinlein’s transnational governments. In: in Extrapolation, 1999. (Link)
- Medosch, Armin: Starship Troopers. Pulp SciFi im Look der dreißiger Jahre. Telepolis vom 20.01.1998. (Link)
- Miller, John J.: Centenary a modern sci-fi giant. In: National Review Magazine vom 30.06.2007. (Link)
- Mühlbauer, Peter: Das Recht auf Unglück. Teil 4: Von utopischen Dystopien und dystopischen Utopien. In: Telepolis vom 15.03.2001. (Link)
- Mühlbauer, Peter: Final Frontiers. Teil 3: Die Rolle der Science Fiction in der Entwicklung libertärer Ideologie. In: Telepolis vom 31.01.2001. (Link)
- Narveson, Jan: Libertarianismus: Eine Philosophische Einführung. Übersetzung: Peter Kopf. In: Aufklärung und Kritik 2/2004, S. 5-37.
- Neumann, Franz (Hrsg.): Handbuch politische Theorien und Ideologien, 1+2.
- Panshin, Alexei: Heinlein in Dimension: A Critical Analysis. Chicago: Advent Publishers 1968.
- Patterson, William H.: Robert A. Heinlein. A biography. (Link)
- Perniciaro, Leon: Shifting Understandings of Imperialism: A Collision of Cultures in Starship Troopers and Ender’s Game. University of New Orleans Theses and Dissertations. Paper 1338. New Orleans 2011.
- Riggenbach, Jeff: Was Robert A. Heinlein a Libertarian? (Link)
- Robinson, Spider: Rah, Rah, R. A. H.! Veröffentlichung ursprünglich 1980. (Link)
- Smith, L. Neil: Robert Heinlein Remembered. In: Fall/Winter 1988 issue of NOMOS. (Link)
- Weuve, Christopher: Thoughts on Starship Troopers. (Link)
- Wooster, Martin Morse: Heinlein’s Conservatism. In: NATIONAL REVIEW ONLINE vom 25.10.2010. (Link)


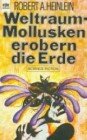
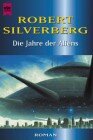
Interessanterweise bin ich derzeit gerade an einem längeren Artikel zum Thema “Starship Troopers” als Utopie. Spontan kann ich vielem, was Du schreibst zustimmen. Ich finde es in der Tat auch auffallend, dass das Buch, das als einer der Ur-Romane der Military SF gilt, im Grunde nur wenig Handlung resp. Action aufweist. Das für Heinlein typische “Preaching” ist sehr ausgeprägt und führt den Roman überraschend in die Nähe klassischer Utopien. Dass der Roman nach wie vor so beliebt ist, finde ich angesichts seiner Handlungsarmut erstaunlich.
Was ich ebenfalls interessant finde, ist dass Heinlein in meinen Augen sein eigentliches Ziel vollkommen verfehlt. Gemäss Heinleins eigener Aussage – auch im Zusammenhang mit der von Dir erwähnten “Patrick Henry League“ – geht es darum, dass Freiheit etwas ist, dass vom Individuum immer wieder erkämpft werden muss. Dass der Einzelne durchaus seine Verpflichtung gegenüber dem Staat hat (und hier ist Heinlein in der Tat kein klassischer Libertarier, obwohl er sich selbst durchaus als solchen bezeichnet hat). Die Ironie ist nun, dass dies im Buch nicht geschieht. Rico meldet sich nicht aus staatsbürgerlicher Verantwortung beim Militär, sondern eher zufällig. Er macht auch keinen intellektuellen Reifeprozess durch. Und seine Veränderung im Laufe der Ausbildung, das “getting over the hump” wird sehr explizit als etwas Körperliches beschrieben. Plötzlich sind die ganzen Strapazen und der Drill nicht mehr so schlimm, hat sich Rico an alles gewöhnt. Was Heinlien beschreibt, ist mehr eine Art Konditionierung und nicht das Ergebnis einer philosophisch-ethischen Reflexion. Das leitende Prinzip der Gesellschaft von «Starship Troopers» ist Gewalt (das zeigt sich auch bei den Ausführungen zur Erziehung. Rico wird nicht Berufsmilitär, weil er intellektuell etwas begriffen hat, sondern weil man den militärischen Drill in ihn hineingeprügelt hat.
Hallo Simon,
danke für Deinen ausführlichen Kommentar.
In meinem eigenen Blog habe ich die Langfassung der Rezension veröffentlicht, auf dieser Seite liest Du nur die stark gekürzte Variante.
Über das Buch gibt es eine Menge zu schreiben. Ich wollte irgendwann keine weiteren Fässer mehr aufmachen und habe es bei den für mich wichtigsten Aussagen belassen. Ich habe Starship Troopers in der deutschen Fassung gelesen, von daher weiß ich nicht, ob im englischen Original bezüglich des einen oder anderen Aspekts eine abweichende Konnotation vorliegt.
Aber ich stimme Dir zu, dass ich beim Schreiben des Textes Probleme hatte die Theorie mit der Realität im Buch zu vereinbaren. Allerdings teile ich nicht Deine Meinung, dass die Konditionierung Ricos Charakter prägt, denn die mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung nimmt nicht wenig Umfang in Heinleins Beschreibung ein. Es geht dabei ja auch um das Miteinander von körperlicher und geistiger Konditionierung.
Über Starship Troopers lässt sich sicherliche seitenweise Text füllen und bei jedem Durchlesen fällt einem etwas neues auf.
Grüße
Galaxyquest
Es gibt eine mathematisch-naturwissenschaftliche Ausbildung (da zeigt sich auch, wie so oft, der Ingenieur Heinlein), aber der zentrale Punkt des Romans, die Erkenntnis, dass die Bereitschaft, sich für die Gemeinschaft zu opfern, den höchsten Wert darstellt, ist im Falle Ricos keine intellektuelle Erkenntnis. Zum Entscheid, nach Abschluss der Grundausbildung beim Militär zu bleiben, gelangt Rico nicht durch Mathematik o.ä.. Zu Beginn, als ihm dies in der Schule erklärt wird, glaubt/versteht er es noch nicht. Auch später, in der Ausbildung “versteht” er es eigentlich nicht. Der Moment, als Rico “ankommt”, ist während des körperlichen Trainings.
Beim Thema “Krieg ist kein Selbstzweck” gibt’s übrigens auch ein Problem: Die Gesellschaft von «Starship Troopers» benötigt einen grossen militärischen Apparat, ansonsten wäre potenziellen Interessenten ja die Möglichkeit verbaut, citizens zu werden. Mit einem kleinen “Friedensheer” würde das System nicht mehr funktionieren. Der Krieg ist letztlich der Idealzustand dieser Gesellschaft; andernfalls hätte man ein riesiges stehendes Heer, das nichts zu tun hat (das ein grosses stehendes Heer dazu verleitet, eher kriegerisch aktiv zu werden, ist ja keine neue Einsicht).
Die ausführlichere Version werde ich mir gleich mal anschauen.
Wobei die von Dir angeführten Thesen/Kritikpunkte auch in der ausführlichen Version nicht angesprochen werden.
Der Krieg hat in Starship Troopers aber noch eine andere Funktion: Indem die Bugs als der absolute Feind im Sinne Schmitts markiert werden, der unbedingt vernichtet werden muss, ergibt sich a) die Legitimierung des riesigen Militärapparates und b) die ständige Angst der Bevölkerung vor einem Angriff der Bugs. Insofern ist das Militär ein Selbstzweck – es bekämpft einen Feind und schützt die Erde. Vielleicht interpretiere ich da zuviel hinein, deshalb habe ich es in meiner Buchbesprechung auch nicht erwähnt, aber vielleicht ist der Krieg notwendig um die innere Einheit zu bewahren.
Das mit dem Bundesdienst (Militärdienst, Dienst für die Regierung) ist generell ein Problem, denn Heinlein selbst sagte im Nachgang, dass durch diesen Dienst 95 Prozent der erwachsenen Bevölkerung irgendwann wählen dürften. Das wiederum hebelt aber den „elitären“ Charakter des Wahlrechts aus.
Das mit Ricos „Ankommen“ im Militär ist ein Punkt für Dich. Ich selbst habe diese Stelle nicht so ganz verstanden. Mir wurde beim Lesen der Sinneswandel nicht klar. Andererseits stehen die Jungs unter Drogen und Hypnose, dass kritikfähige Aussagen dabei nicht zustande kommen, versteht sich von selbst.
(Ich merke. Starship Troopers ist ein buch, über das man herrlich diskutieren kann. Ich werde es wieder aus meiner Bücherkiste holen und später noch ein weiteres Mal lesen).
Das mit dem Sinneswandel ist eben wirklich eine Schwäche des Romans. Es handelt sich, wie Du ja auch schreibst, um einen Bildungsroman. Unüberlegter Schulbube wird zum verantwortungsbewussten Bürger/Soldaten. Dieser Prozess ist aber weitgehend behauptet resp. wird nur an dem Punkt sichtbar, als Rico meint, dass er “über den Berg” ist.
Nur noch kurz zur Frage, wer Dienst leisten kann: Du erwähnst ja Heinleins eigene Aussage (aus »Extended Universe«), dass es sich nicht um Militärdienst, sondern um “feder service” handle. Für mich ein weiterer Punkt, wo der Roman offensichtlich etwas anderes erzählt als sein Autor intendiert. Den Artikel von Gifford kennst Du ja. Seiner Analyse, dass im Roman ausschliesslich von militärischem Dienst die Rede ist, kann man in meinen Augen wenig entgegen halten (seine These, dass Heinleins Kommentar einfach Geplauder sei, überzeugt mich aber nicht so recht).
Dass ein Autor etwas in einem Buch sieht, das gar nicht drinsteht, ist nicht so ungewöhnlich. Wenn das fertige Buch in zwei zentralen Punkten aber nicht der ausdrücklichen Intention des Autors entspricht, ist das doch etwas seltsam. Für mich sind das Indizien dafür, dass Heinlein »Starship Troopers« in seinem Henry-League-Furor relativ schnell runtergeschrieben und vieles nicht sorgfältig durchgedacht respektive ausgeführt hat (reine Vermutung. Ich kann das natürlich nicht belegen ausser anhand der offensichtlichen Widersprüche),