Das Pandemie-Szenario in der Literatur
 In der Ermangelung weitergehender technischer Möglichkeiten blieben die Autoren vor dem ersten Weltkrieg bei der Entwicklung glaubwürdiger literarischer Apokalypsen weitgehend auf Katastrophen natürlicher Herkunft – wie unsere kleinen Freunde, die Viren – beschränkt. Links im Bild ist übrigens Mr. Ebola zu sehen, der aufgrund seiner kurzen Inkubationszeit trotz seiner hohen Morbiditätsrate eher nicht zu den Kandidaten für die Apokalypse zählt, weil er für eine sich weltweit ausbreitende Epidemie – die sogenannte Pandemie – einfach zu schnell tötet. Dabei muss man allerdings beachten, dass die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte natürlich zahllose Erfahrungen mit verheerenden Seuchen gemacht hat, andererseits jedoch noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein vermutet wurde, dass Miasmen – üble Ausdünstungen – und nicht Viren oder Bakterien für Infektionen verantwortlich wären. Dieses gilt sowohl für die Pestepidemie des Mittelalters (1347-1353), die vermutlich über zwei Drittel der Europäer das Leben kostete, als auch beispielsweise für die anfangs des 19. und bis ins 20. Jahrhundert hinein grassierenden Choleraepidemien in Europa. Erst die Arbeiten von Louis Pasteur und Robert Koch bewiesen Mitte des 19. Jahrhunderts endgültig, dass winzige Lebewesen verantwortlich sind. Dass es Viren, also Geschöpfe, kleiner als Bakterien gibt, wurde sogar erst um 1900 nach und nach bewiesen, denn ganz leicht war das aufgrund ihrer Größe nicht – für so etwas Handfestes wie das Fahndungsbild von Mr. Ebola bedarf es schließlich eines Elektronenmikroskops, und das wurde erst im Laufe der 20er und 30er Jahre allmählich entwickelt.
In der Ermangelung weitergehender technischer Möglichkeiten blieben die Autoren vor dem ersten Weltkrieg bei der Entwicklung glaubwürdiger literarischer Apokalypsen weitgehend auf Katastrophen natürlicher Herkunft – wie unsere kleinen Freunde, die Viren – beschränkt. Links im Bild ist übrigens Mr. Ebola zu sehen, der aufgrund seiner kurzen Inkubationszeit trotz seiner hohen Morbiditätsrate eher nicht zu den Kandidaten für die Apokalypse zählt, weil er für eine sich weltweit ausbreitende Epidemie – die sogenannte Pandemie – einfach zu schnell tötet. Dabei muss man allerdings beachten, dass die Menschheit im Laufe ihrer Geschichte natürlich zahllose Erfahrungen mit verheerenden Seuchen gemacht hat, andererseits jedoch noch bis weit ins 19. Jahrhundert hinein vermutet wurde, dass Miasmen – üble Ausdünstungen – und nicht Viren oder Bakterien für Infektionen verantwortlich wären. Dieses gilt sowohl für die Pestepidemie des Mittelalters (1347-1353), die vermutlich über zwei Drittel der Europäer das Leben kostete, als auch beispielsweise für die anfangs des 19. und bis ins 20. Jahrhundert hinein grassierenden Choleraepidemien in Europa. Erst die Arbeiten von Louis Pasteur und Robert Koch bewiesen Mitte des 19. Jahrhunderts endgültig, dass winzige Lebewesen verantwortlich sind. Dass es Viren, also Geschöpfe, kleiner als Bakterien gibt, wurde sogar erst um 1900 nach und nach bewiesen, denn ganz leicht war das aufgrund ihrer Größe nicht – für so etwas Handfestes wie das Fahndungsbild von Mr. Ebola bedarf es schließlich eines Elektronenmikroskops, und das wurde erst im Laufe der 20er und 30er Jahre allmählich entwickelt.

Während im ersten moderne postapokalyptische Roman, Cousin de Granvilles Roman Le Dernier Homme aus dem Jahre 1805 die Ursache für die fortschreitende Sterilität der Menschen nicht genannt wird und die Apokalypse noch deutlich metaphysische Züge trägt, verfasste gut 20 Jahre später (1826) die berühmte Mary W. Shelley ein ähnliches Werk: Verney, der letzte Mensch. Hier lassen Krieg und Seuchen nur ein Exemplar unserer Spezies am Leben (Um der Wahrheit die Ehre zu geben: Meistens bleiben doch noch zwei übrig – letzten Endes findet der Protagonist meistens noch seine Eva und wird so zum ehrvollen Stammvater eines neuen Menschengeschlechts). Damit greift sie anhand eines Seuchenszenarios das von Granville entwickelte Motiv des letzten Menschen auf. Allerdings ist nicht ganz klar, wie stark diese Werke tatsächlich von den nachfolgenden Autoren rezipiert wurden. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ging die Produktion von Romanen mit dem Seuchenmotiv etwas zurück – neue technische Errungenschaften wie z.B. die Atombombe deuteten sich an [siehe hierzu: Rolf Tzschaschel: Die Entwicklung Atomkriege in der Science Fiction, in: Das nukleare Jahrhundert: Eine Zwischenbilanz, 226-250, S.230.]. Dennoch erfuhr das Genre im 20 Jahrhundert zahlreiche Neuerungen:
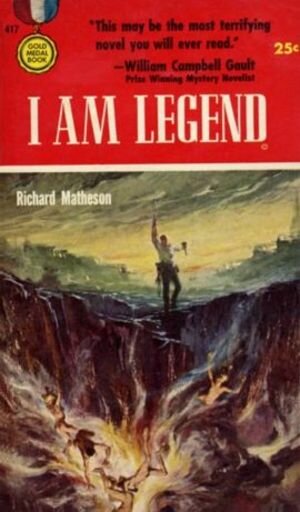 In Richard Mathesons Roman I am Legend aus dem Jahr 1954 führt eine Seuche zur Verwandlung aller Menschen (bis natürlich auf den einen Letzten bzw. die letzten Zwei) in Vampire. Dieser Roman hatte einen sehr großen Einfluss auf die nachfolgende Horrorliteratur, die den Vampir nun durch den aus dem Horrorfilm der Dreißiger Jahre bekannten Zombie ersetzte, so dass ein weiteres Subgenre entstand: Die Zombie-Apokalypse. Aber darüber gibt es dann einen eigenen Artikel.
In Richard Mathesons Roman I am Legend aus dem Jahr 1954 führt eine Seuche zur Verwandlung aller Menschen (bis natürlich auf den einen Letzten bzw. die letzten Zwei) in Vampire. Dieser Roman hatte einen sehr großen Einfluss auf die nachfolgende Horrorliteratur, die den Vampir nun durch den aus dem Horrorfilm der Dreißiger Jahre bekannten Zombie ersetzte, so dass ein weiteres Subgenre entstand: Die Zombie-Apokalypse. Aber darüber gibt es dann einen eigenen Artikel.
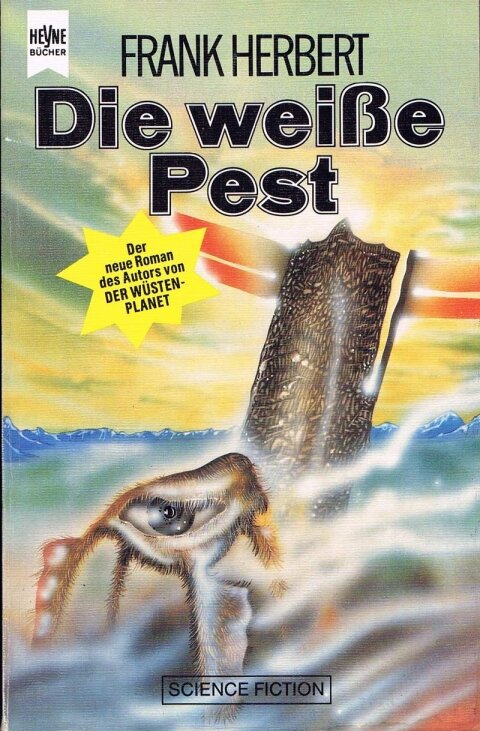 Mit der Entdeckung der DNA und der Erkenntnis, dass diese sich durch den Menschen manipulieren lässt, erfuhr das Genre eine leichte Veränderung. In Frank Herberts Roman Die Weiße Pest beispielsweise sterben nur die Frauen aufgrund eines gentechnisch veränderten Virus – womit jedoch ebenfalls das Ende der Menschheit besiegelt scheint. In Margaret Atwoods Roman Oryx und Crake aus dem Jahr 2003 sind jedoch alle Menschen dran – und jedes Mal ist ein verrückter Wissenschaftler respektive Gentechniker dafür verantwortlich, ebenfalls ein sehr häufig in diesem Subgenre anzutreffendes Motiv. Jetzt scheint beinahe alles möglich. Natürlich verlässt das Genre damit eigentlich den Bereich der natürlichen Katastrophen, dringt jedoch noch nicht ganz in den der technisch begründeten Apokalypsen vor.
Mit der Entdeckung der DNA und der Erkenntnis, dass diese sich durch den Menschen manipulieren lässt, erfuhr das Genre eine leichte Veränderung. In Frank Herberts Roman Die Weiße Pest beispielsweise sterben nur die Frauen aufgrund eines gentechnisch veränderten Virus – womit jedoch ebenfalls das Ende der Menschheit besiegelt scheint. In Margaret Atwoods Roman Oryx und Crake aus dem Jahr 2003 sind jedoch alle Menschen dran – und jedes Mal ist ein verrückter Wissenschaftler respektive Gentechniker dafür verantwortlich, ebenfalls ein sehr häufig in diesem Subgenre anzutreffendes Motiv. Jetzt scheint beinahe alles möglich. Natürlich verlässt das Genre damit eigentlich den Bereich der natürlichen Katastrophen, dringt jedoch noch nicht ganz in den der technisch begründeten Apokalypsen vor.
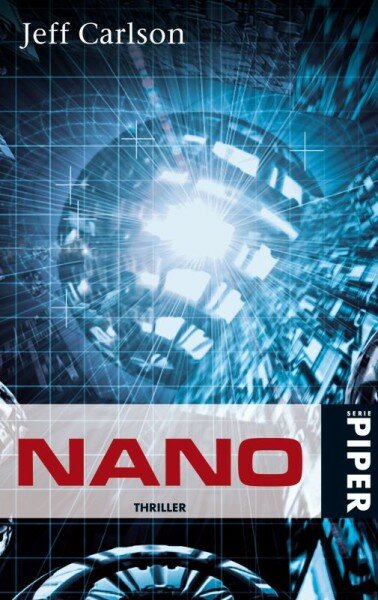 Die Entwicklung der Nano-Technologie ermöglicht dieses zuletzt doch noch: Während Michael Crichtons Protagonist in dem 2002 erschienen Roman Die Beute das hausgemachte Ende möglicherweise noch abwehren kann, ist es in Jeff Carlons Endzeitroman Nano schon passiert: Winzige sich selbst reproduzierende Roboter haben große Teile der Menschheit bei lebendigem Leibe aufgelöst und weite Bereiche der Erde verseucht, so dass sich die Überlebenden sich in die rettenden höher gelegenen – aber leider wenig lebenswerten – Regionen zurückziehen müssen.
Die Entwicklung der Nano-Technologie ermöglicht dieses zuletzt doch noch: Während Michael Crichtons Protagonist in dem 2002 erschienen Roman Die Beute das hausgemachte Ende möglicherweise noch abwehren kann, ist es in Jeff Carlons Endzeitroman Nano schon passiert: Winzige sich selbst reproduzierende Roboter haben große Teile der Menschheit bei lebendigem Leibe aufgelöst und weite Bereiche der Erde verseucht, so dass sich die Überlebenden sich in die rettenden höher gelegenen – aber leider wenig lebenswerten – Regionen zurückziehen müssen.
Natürlich können meine Ausführungen hier nur einige Aspekte dieses Subgenres, in dem sich bestimmt auch noch in den nächsten Jahren Spannendens tun wird, umreißen. Solltet ihr Anregungen oder Verbesserungsvorschläge haben, so zögert nicht, die Kommentarfunktion zu benutzen.


